Wer E sagt, muss auch U sagen – Über die Verträge von Lissabon, Teil I: Wie es dazu kam
Wer E sagt, muss auch U sagen – Über die
Verträge von Lissabon,
Teil I: Wie es dazu kam
Auf die Füße kommt unsere Welt erst wieder,
wenn sie sich beibringen
lässt, dass ihr Heil nicht in neuen Maßnahmen, sondern in neuen
Gesinnungen besteht. Albert Schweitzer
lässt, dass ihr Heil nicht in neuen Maßnahmen, sondern in neuen
Gesinnungen besteht. Albert Schweitzer
Europäische Union. Es ist schon seltsam: Seit 1957 in Rom der erste Schritt in Richtung Europa gegangen wurde, der 1979 schließlich zum ersten Europäische Parlament führte, das wiederum den Prozess in Gang brachte, welcher letztlich zum Maastrich-Vertrag führte (der als Beginn der EU zu sehen ist), regen sich die Menschen – nicht nur, aber vor allem in Deutschland – über Europa auf. Ganz gleich wie eindringlich man immer wieder erklärt, welchen Fortschritt – vor allem den Deutschen – Europa gebracht hat, die diffuse Skepsis ist offenbar nicht zu zerstreuen.
Es ist im Grunde ja auch gar nicht meine Absicht Skepsis zu beseitigen, denn als Skeptiker – als den ich mich selbst bezeichne – schätze ich die Vorteile einer gesunden Skepsis sehr hoch; besonders gegenüber politischen Verhältnissen. Um was es mir geht ist, diese diffuse Skepsis zu überwinden. Diese diffuse Skepsis ist zum großen Teil aus Nicht- oder Teilwissen (letzteres vielleicht schlimmer als ersteres) gespeist, zu einem weiteren Teil von Gegenpropaganda hauptsächlich
konservativer politischer Parteien (die ihr eigenes nationales Versagen einfach nach Europa schiebt) und natürlich eine von Europa selbst verschuldete Intransparenz der Institutionen.
Natürlich sind die Verhältnisse nach und nach komplizierter
geworden. Während es anfangs nur sechs Staaten – Belgien, die BR Deutschland, Frankreich,
Italien, Luxemburg und die Niederlande – waren (die außerdem viele gemeinsame
Interessen hatten und als Initiatoren sozusagen die Idee verkörperten), wurden
mit jeden Beitritt (1973 Dänemark, Großbritannien und Irland sowie in den
1980er Jahren die Süderweiterung Griechenland, Spanien und Portugal) die
Transparenz kleiner und Probleme größer. Ich möchte nicht im Einzelnen auf die
Art der Probleme (das würde den Rahmen dieses Artikels sprengen), sondern vor
allem auf die organisatorischen und die politischen Bedingungen eingehen.
Von der EWG zum Europaparlament
Die Europäische Einigung erfolgte in Etappen,
was – eingedenk der Geschichte des Kontinents – nicht verwundern kann;
Jahrhunderte lang hatte fast jeder Staat Europas gegen fast jeden anderen Krieg
geführt. Der Gedanke, nachdem wirklicher Fortschritt nicht in Konfrontation, sondern
nur in Kooperation möglich ist (auch wenn diese Kooperation zunächst
vordergründig nur die Wahrung eigener Interessen zum Ziel hatte), legte die
Saat. Die Frucht, die daraus heranwachsen sollte, sollte ein Kontinent sein,
auf dem dauerhaft Frieden und Wohlstand herrscht.
Die Mutter des friedlich geeinten, modernen
Europa, ist Frankreich und der Vater war der französische Außenminister Robert
Schuman; gezeugt am 9. Mai 1950, geboren 1951 als EGKS, Gewicht: die sechs
Staaten Belgien, die Bundesrepublik Deutschland,
Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Die Wiege steht in Paris,
wo der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS) unterzeichnet wurde. Schon 1952 tritt erstmals die "Gemeinsame
Versammlung" der EGKS in Straßburg zusammen; Mitglieder sind 78 Abgeordnete aus den nationalen Parlamenten der sechs Mitgliedsstaaten. Die Versammlung hat noch keine Gesetzgebungsrechte.
Versammlung" der EGKS in Straßburg zusammen; Mitglieder sind 78 Abgeordnete aus den nationalen Parlamenten der sechs Mitgliedsstaaten. Die Versammlung hat noch keine Gesetzgebungsrechte.
Die nächste Etappe wurde 1957 gestartet. In Rom
gründen die sechs EGKS-Staaten die EWG (die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft) und die EURATOM (Europäische Atomgemeinschaft). Leider
verschob sich damit die Gewichtung eher auf die wirtschaftliche Seite und die
politische Seite – die noch in der Entstehungsphase im Vordergrund stand,
geriet ins Hintertreffen. Trotzdem wird 1958 die Zuständigkeit der parlamentarischen
Versammlung auf alle drei Gemeinschaften EGKS, EWG und EUR ATOM ausgeweitet.
Die Versammlung hat zu diesem Zeitpunkt 142 Abgeordnete und gibt sich selbst
den Namen Europäisches
Parlament" (etwas selbstgerecht, gewiss, denn ein richtiges Parlament wird bekanntlich gewählt). Übrigens wurden erst im Jahre 1967 aus den Räten und Kommissionen der drei Gemeinschaften, einheitliche Organe.
Parlament" (etwas selbstgerecht, gewiss, denn ein richtiges Parlament wird bekanntlich gewählt). Übrigens wurden erst im Jahre 1967 aus den Räten und Kommissionen der drei Gemeinschaften, einheitliche Organe.
Ein wichtiger Schritt hin zu einem richtigen
Parlament erfolgte 1970. In diesem Jahr erhielt die Gemeinschaft erstmals eigene
Einnahmen; zuvor war sie durch Beiträge der Mitgliedsstaaten finanziert worden.
Damit wurde eine Haushaltsgesetzgebung nötig. Die Mitgliedsstaaten räumen dem
sog. Parlament erstmals gesetzgeberische Befugnisse ein. Seither ist es an der
Aufstellung und Verabschiedung des Haushalts beteiligt. Nachdem die
Gemeinschaft 1973 um drei weitere Staaten (Dänemark,
Großbritannien und Irland) wächst, sieht die mitteleuropäische Landkarte (wenn man die Länder einheitlich einfärbte) schon richtig gut aus; vor allem weil nun endlich eines der Mutterländer der Europäischen Idee (was wenig bekannt ist und oft vergessen wird) nun endlich mit von der Partie war: Großbritannien. Und 1979 war es dann endlich politisch soweit, dass die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zum ersten Mal direkt gewählt wurden.
Großbritannien und Irland) wächst, sieht die mitteleuropäische Landkarte (wenn man die Länder einheitlich einfärbte) schon richtig gut aus; vor allem weil nun endlich eines der Mutterländer der Europäischen Idee (was wenig bekannt ist und oft vergessen wird) nun endlich mit von der Partie war: Großbritannien. Und 1979 war es dann endlich politisch soweit, dass die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zum ersten Mal direkt gewählt wurden.
Vom Parlament zum Konvent
Die 1980er Jahre waren – in Bezug auf die
Europäische Gemeinschaft – zum einen geprägt durch das Programm der sog.
Süderweiterung (1981 wird Griechenland und 1986 werden Spanien und Portugal
Mitglied), zum anderen gewannen natürlich die weitreichenden Veränderungen im Osten
an Bedeutung; und das nicht nur auf Europa bezogen. Die alte Politikerphrase
„Nichts wird je wieder so sein wie es war“ wurde und wird häufig gebraucht und
selten trifft sie so zu, wie am Ende des Jahrzehnts.
Ein politischer Effekt der Gemeinschaft wird
oft völlig ausgeblendet: Die Gemeinschaft ist ein Friedensprojekt für
(mindestens) Europa. In diesen Zusammenhängen ist die Gemeinschaft – bei aller
berechtigten Kritik – nicht genug zu loben; sie war auch ein Schlüssel zur
Deutschen Einigung. Gerade die Menschen im Deutschen Osten, sollten höchstes
Interesse an der Gemeinschaft aufbringen, denn ohne die Hilfen der Gemeinschaft
sähen die "blühenden Landschaften" noch trostloser aus. Insofern ist
die Gemeinschaft auch ein innenpolitischer Stabilisator in Deutschland.
Die 1990er Jahre sollten die Änderung von der
Europäischen Gemeinschaft hin zur Europäischen Union bringen. 1992 wurden das Europäische
Parlament durch den " Maastrichter Vertrag" mit neuen Rechten und
Kompetenzen ausgestattet und die langjährigen Vorarbeiten für den Binnenmarkt
abgeschlossen; dem dann 1995 Finnland, Österreich und Schweden beigetreten
sind. 1999 wurde der Euro als offizielles Zahlungsmittel (das Bargeld sollte ab
2002 folgen) in elf Mitgliedsstaaten eingeführt; zwei Jahre später kam
Griechenland als zwölftes Mitglied dazu. In diesem Jahr 2001 wird auch der
"Vertrag von Nizza" unterzeichnet: die vierte umfassende Änderung der
Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union.
Die Umwälzungen im Osten hatten die
Gemeinschaft auch vor die Frage gestellt, wo die Grenzen Europas sind und
inwieweit ihre Integrationskraft die politischen Verhältnisse unter diesen
neuen Bedingungen stabilisieren könnte. Seit 1998 bzw. seit 2000 wurden mit Estland,
Lettland, Litauen, Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Slowenien,
Ungarn sowie den Mittelmeerstaaten Malta und Zypern Verhandlungen über ihren
Beitritt geführt. 2002 wurde schließlich beschlossen, dass diese Länder am 1.
Mai 2004 beitreten können.
Bereits in der Entstehungsphase des
europäischen Einigungsprojekts nach dem Zweiten Weltkrieg waren die bis heute
fortwirkenden konzeptionellen Unterschiede angelegt, deren einer Pol auf eine bundesstaatliche
Ordnung zielt (die Vereinigten Staaten von Europa im Sinne Churchills), während
der andere auf einen mehr oder minder losen Staatenbund hinausläuft (das Europa
der Vaterländer im Sinne de
Gaulles). In diesem Spannungsfeld von Zielvorstellungen hat sich auf der Grundlage von Verträgen zwischen den zum jeweiligen Zeitpunkt zugehörigen Mitgliedstaaten das derzeit bestehende Institutionengefüge herausgebildet.
Gaulles). In diesem Spannungsfeld von Zielvorstellungen hat sich auf der Grundlage von Verträgen zwischen den zum jeweiligen Zeitpunkt zugehörigen Mitgliedstaaten das derzeit bestehende Institutionengefüge herausgebildet.
Es ist bis heute immer noch die Schwäche der
EU, dass man sich eigentlich noch immer "in der Entstehungsphase des
europäischen Einigungsprojekts" befindet. In der Betrachtung der großen
Linien (Churchill – de Gaulle), kann man auch widerstreitende Interessen in den
einzelnen Mitgliedsstaaten erkennen; z.B. hat die deutsche Arbeiterbewegung –
trotz der deutsch-französischen Aussöhnung – immer eher das Churchill-Model
mehr favorisiert. Ich bekenne, dass das auch meine Haltung ist. Die heutige
Konstituierung zeigt, dass sich eher die (konservative) „de Gaulle-Linie“
durchgesetzt hat. Insofern ist meine Forderung einer Neu-Konstituierung der EU
grundsätzlicher Art: Ich will die Vereinigten Staaten von Europa.
Also spätestens 2002 wurde klar, dass Europa
neu konstituiert werden muss, da es sich sonst nach dem Beitritt der zehn
Kandidaten organisatorisch und politisch sehr schwertun und vielleicht nicht
mehr handlungsfähig sein würde. Im Februar beginnt der Konvent zur Zukunft Europas
seine Arbeiten an einer weiteren umfassenden Änderung des EG- und EU-Vertrages.
Die Union sah sich also für die kommenden Jahre vor neue Herausforderungen
gestellt. Aus der Wirtschaftsgemeinschaft war eine politische Gemeinschaft
geworden, die sich nicht nur um einen funktionierenden Binnenmarkt kümmert,
sondern auch um Fragen wie die innere Sicherheit und die gemeinsame
Außenpolitik, um Beschäftigung, soziale Sicherheit oder den Umweltschutz.
Diese Aufgaben sollen in einer Union von 27
Mitgliedsstaaten (ab 2004) mit fast 500 Millionen Menschen nicht nur effektiv,
sondern auch demokratisch bewältigt werden. Die größere Union sollte auch in
Zukunft handlungsfähig sein; zugleich sollten Mitsprache, Transparenz und Schutz
der Bürgerrechte gewährleistet sein. Hierfür die nötigen Voraussetzungen zu
schaffen, war das ehrgeizige Ziel des Projekts Europäische Verfassung.
In einem mehrjährigen Diskussionsprozess (der
allerdings weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt wurde und
bei dem eher die Konservativen das Wort führten) entstand eine neue vertragliche
Grundlage für das gemeinsame Handeln im erweiterten Europa. Im Oktober 2004
wurde der Verfassungsvertrag von den Staats-und Regierungschefs feierlich
unterzeichnet. Damit war die Debatte über
die Zukunft Europas aber nicht beendet. In allen Mitgliedsstaaten musste der Vertrag nach den jeweiligen demokratischen Verfahren ratifiziert werden. Der Prozess der Ratifizierung hat in vielen Ländern Diskussionen ausgelöst, die weit über die konkreten Inhalte des Verfassungsvertrags hinausgingen.
die Zukunft Europas aber nicht beendet. In allen Mitgliedsstaaten musste der Vertrag nach den jeweiligen demokratischen Verfahren ratifiziert werden. Der Prozess der Ratifizierung hat in vielen Ländern Diskussionen ausgelöst, die weit über die konkreten Inhalte des Verfassungsvertrags hinausgingen.
Einerseits gab es eine von der Rechten
geschürte (bis heute andauernde) nationalistische Stimmungsmache, ein
Flämmchen, das von den Konservativen stets auch dazu benutzt wurde ihr eigenes
Süppchen darauf zu kochen (siehe auch „das Europa der Vaterländer“). Aber ich werfe
ihnen auch vor, dass sie oft genug Europa dazu missbraucht haben, damit es ihre
falsche neoliberale Politik umsetzt und um
anschließend bequem politische Schuldzuweisungen für eigene politische Fehler loswerden zu können. Andererseits gab es gerade wegen der neoliberal geprägten Grundhaltung des Verfassungswerkes Kritik von der Linken, die seit jeher mehr wollten als ein lockerer Staatenbund (siehe auch „Vereinigten Staaten von Europa“) und überdies die zutiefst europäischen Errungenschaften des Sozialstaatsprinzips in Gefahr sahen; es gab auch noch andere Kritikpunkte.
anschließend bequem politische Schuldzuweisungen für eigene politische Fehler loswerden zu können. Andererseits gab es gerade wegen der neoliberal geprägten Grundhaltung des Verfassungswerkes Kritik von der Linken, die seit jeher mehr wollten als ein lockerer Staatenbund (siehe auch „Vereinigten Staaten von Europa“) und überdies die zutiefst europäischen Errungenschaften des Sozialstaatsprinzips in Gefahr sahen; es gab auch noch andere Kritikpunkte.
Von der Verfassung zum Reformvertrag
Die Quittung erhielt die Europäische
Nomenklatur bei den Referenden in Frankreich am 29. Mai 2005 und in den
Niederlanden am 1. Juni 2005: Der Vertrag über eine Verfassung für Europa wurde
von den Bürgerinnen und Bürgern abgelehnt. In den meisten Ländern fanden keine Volksbefragungen
statt, sondern die Parlamente entschieden. Die Parlamente von 14 Ländern hatten
den Verfassungsvertrag gebilligt. Was weitgehend unbekannt ist: in einem dieser
Länder allerdings konnte
der Vertrag nicht ratifiziert werden, weil das nationale Verfassungsgericht ein Veto einlegte – Deutschland. In zwei weiteren Ländern (Spanien und Luxemburg) wurde in Referenden für den Vertrag gestimmt. Auch das Europäische Parlament hatte sich im Januar 2005 mit großer Mehrheit für den Vertrag über eine Verfassung für Europa
ausgesprochen.
der Vertrag nicht ratifiziert werden, weil das nationale Verfassungsgericht ein Veto einlegte – Deutschland. In zwei weiteren Ländern (Spanien und Luxemburg) wurde in Referenden für den Vertrag gestimmt. Auch das Europäische Parlament hatte sich im Januar 2005 mit großer Mehrheit für den Vertrag über eine Verfassung für Europa
ausgesprochen.
Nach den ablehnenden Referenden in Frankreich
und den Niederlanden hatten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem
Gipfeltreffen im Juni 2005 beschlossen, eine Reflexionsphase einzuleiten (ein
anderes Wort für Wunden lecken), um eine breite und intensive Debatte – mit Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger, der Zivilgesellschaft, der nationalen Parlamente,
der Sozialpartner und der Parteien – über die Verfassung und die Zukunft
Europas zu ermöglichen. Der Verfassungsvertrag – noch gar nicht in Kraft –
musste schon reformiert werden. Diese Phase, in der fast nichts geschah,
dauerte bis 2007. Die deutsche Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007
wollte den Prozess der Vertragsreform wieder in Gang zu bringen.
Es gelang, vom Europäischen Rat einen Fahrplan
verabschieden zu lassen, nach dem dieser Reformprozess fortgesetzt wird. Auf
dem Gipfeltreffen in Brüssel am 21. und 22. Juni 2007 die Eckpunkte für einen künftigen
Reformvertrag vereinbart, der an die Stelle des Verfassungsvertrages treten
sollte; das Wort Verfassung wollte niemand mehr in den Mund nehmen.
Wilfried John
Demnächst: Im Teil II geht es um das
Zustandekommen und die Inhalte der Lissabonner Verträge


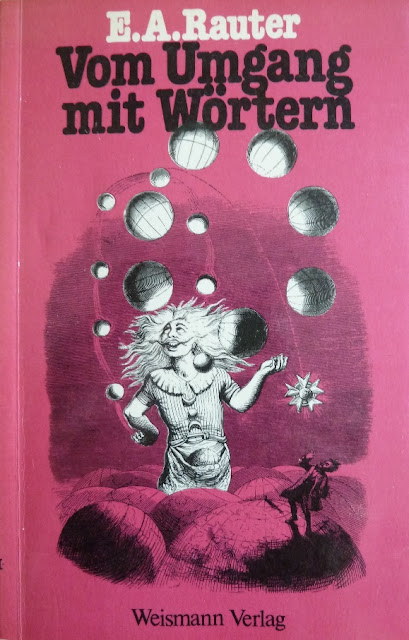
Kommentare
Kommentar veröffentlichen