Komm, spielen wir Schicksal – Über Ausbeutung von Kindern Teil I - Ein Überblick
Komm, spielen wir Schicksal – Über Ausbeutung
von Kindern
Teil I - Ein Überblick
Es gibt keine großen Entdeckungen und keinen
Fortschritt, solange es
noch ein unglückliches Kind auf der Welt gibt. Albert Einstein
noch ein unglückliches Kind auf der Welt gibt. Albert Einstein
Schicksal. Sehr viele Menschen meinen, das Leben würde vom Schicksal
bestimmt. Und was da nicht alles als schicksalhaft angesehen wird… Mit
Schicksal wird alles das bezeichnet, was durch äußere und innere Faktoren nicht
beeinflussbar zu sein scheint. Doch untersucht man die uns umgebenden Phänomene
aber mit dem Kriterium der Unbeeinflussbarkeit, dann bleibt von dem was
Schicksal genannt werden sollte recht wenig übrig. Bei genauerer Betrachtung
kommen dafür nicht einmal alle Naturkatastrophen in Betracht, da einige nur
deswegen entstehen, weil die Menschen wider besseres Wissen z.B. Bergwälder in den
Alpen fällten und dann das Schicksal des Lawinentoten beklagen.
Ganz
gewiss nicht schicksalhaft jedoch, ist die Situation von vielen Millionen
Kinder auf diesem Planeten; wenngleich ihr Leben aus der Sicht vieler dieser
Kinder sicher als schicksalhaft angesehen wird. Doch das wäre nur dann
vollständig richtig, wenn wir sie in diesem Elend allein lassen würden und
stillschweigend über ihr Leid hinweg gingen. Dieser Artikel ist all jenen
Kindern gewidmet, die überall schlimmster Ausbeutung preisgegeben sind – er
entstand anlässlich der diesjährigen Aktionstage der UNICEF gegen Ausbeutung
von Kindern, die in vielen deutschen Städten auf das Los dieser Kinder
aufmerksam machen wollen.
Vor
zehn Jahren verabschiedete die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) die
Konvention 182 gegen die schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Das Dokument
gehört zu den am schnellsten ratifizierten Konventionen der ILO. Bis heute
haben 170 Staaten unterzeichnet. Viele Regierungen haben seither Gesetze zum
Schutz von Kindern vor ausbeuterischer Arbeit erlassen. Kinderarbeit wurde –
endlich – ein international stärker beachtetes Thema. Pilotprojekte der ILO drängten ausbeuterische
Kinderarbeit in einigen Branchen zurück und brachten Arbeitgeber,
Gewerkschaften und Regierungen an einen Tisch.
Kinderarbeit
– ein Überblick
Nach
Schätzungen der ILO sind weltweit 327 Millionen Kinder erwerbstätig. Mehr als
210 Millionen Jungen und Mädchen sind nach dieser Statistik Kinderarbeiter; das
heißt, diese Kinder arbeiten regelmäßig mehrere Stunden. Unter ihnen sind 126
Millionen Kinder unter 15 Jahren, die unter gefährlichen und ausbeuterischen
Bedingungen schuften. Viele von ihnen schuften wie Sklaven und werden wie eine Ware gehandelt.
Leider
steht zu befürchten, dass die Zahlen noch höher sind, da diese Statistik auf
der Basis der Informellen Infrastruktur (Geburtenregister, Einwohnermeldeämter
etc.) der Mitgliedsländer erhoben wurden. Aber leider haben viele Millionen
Menschen gar keinen Zugang zu dieser Daten-Infrastruktur.
Menschenrechtsorganisationen berichten
regelmäßig, dass ein erheblicher Teil der Geburten gar nicht erfasst würden und
so ist überhaupt nicht bekannt, wie viele Kinder es auf der Welt überhaupt
gibt. Der Fehler liegt also in der nicht erfassten Zahl von vielleicht
Millionen von Kindern – Kinder ohne jedes Recht, ohne jede öffentliche
Beachtung, ohne Zukunft… oder einer Zukunft, die alles andere als
erstrebenswert ist.
In
vielen Produkten steckt die Arbeit von Kindern. Kinder schleifen Diamanten,
arbeiten in Steinbrüchen und stickigen Fabriken oder schuften auf Plantagen.
Der Besuch einer Schule bleibt für viele Kinder ein unerreichbarer Traum.
Krasse Ausbeutung von Kindern und Erwachsenen gibt es schon lange – und in immer
neuen Facetten und Ausprägungen. Ziemlich neu aber ist, dass massenhafter
Wohlstand neben erbärmlichster Armut steht und dass Erstere von den anderen
wissen – und dennoch nichts tun. Allerdings macht es aber keinen Sinn,
Arbeit von Kindern pauschal zu verteufeln.
Zur
Definition von Kinderarbeit und Ausbeutung
Nicht
jedes Kind, das arbeitet, wird ausgebeutet. Nicht jede Form der Kinderarbeit
muss bekämpft werden. In vielen Gegenden der Welt hat die Mitarbeit von Kindern
eine wichtige Funktion in der Erziehung: Kinder wachsen so in ihre spätere
Rolle hinein und übernehmen mit ihren wachsenden Fertigkeiten Stück für Stück
Verantwortung. Allerdings darf solche Arbeit nicht in Ausbeutung münden.
Eine
international anerkannte Definition von ausbeuterischer Kinderarbeit liegt seit
1999 mit der ILO-Konvention 182 gegen die schlimmsten Formen der Kinderarbeit
vor. Im Zusammenhang mit der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen
ergeben sich so die wichtigsten Gesichtspunkte für einen Überblick auf Kinderarbeit
frei von Ausbeutung – im Zentrum steht dabei die Verfassung und die Persönlichkeit
jedes einzelnen Kindes und die Frage, ob Arbeit die Bildungschancen
beeinträchtigt.
Ausbeuterische
Kinderarbeit ist laut ILO-Konvention 182:
> Sklaverei und
Schuldknechtschaft und alle Formen der Zwangsarbeit
>
Arbeit
von Kindern unter 13 Jahren
> Kinderprostitution und
-pornographie
>
der
Einsatz von Kindern als Soldaten
>
illegale
Tätigkeiten, wie zum Beispiel Drogenschmuggel
>
Arbeit,
welche die Gesundheit, die Sicherheit oder die Sittlichkeit gefährdet, also zum Beispiel Arbeit in Steinbrüchen, das
Tragen schwerer Lasten oder sehr lange Arbeitszeiten und Nachtarbeit.
Wie
oben schon bemerkt, weiß niemand genau, wie viele Kinder arbeiten: Besonders
die schlimmsten Formen der Kinderarbeit finden in jeder Hinsicht im Verborgenen
statt. Die ILO hat im Frühjahr 2006 einen Bericht über die Situation der
Kinderarbeiter vorgelegt: „Das Ende der Kinderarbeit - zum Greifen nah“ Ganz
davon abgesehen, dass allein der Titel wenigstens als Schönfärberei zu sehen
ist (Naivität scheidet aus, da man das der Organisation nicht unterstellen
kann…), und man 2006 noch nichts von der aktuellen weltweiten Finanzkrise
wusste (welche die erreichten Verbesserungen sämtlich zerstört hat!), enthält
der Bericht Einzelheiten, die für eine sachliche Debatte notwendig sind. Die
ILO unterscheidet im Bericht drei Kategorien:
Ø Erwerbstätige Kinder:
Alle Kinder, die mindestens eine Stunde an einem Tag arbeiten, innerhalb eines
Referenzzeitraums von sieben Tagen. (Anmerkung *1)
Ø Kinderarbeiter: Die
ILO-Statistiker grenzen im Weltreport diese Form der Arbeit von der
erwerbstätiger Kinder ab. Nicht unter die Kategorie »Kinderarbeit« fallen demnach
Kinder über zwölf Jahren, die einige Stunden pro Woche eine erlaubte leichte Arbeit
verrichten, sowie Kinder über 15 Jahren, deren Arbeit als nicht gefährlich«
eingestuft ist. (Anmerkung*2)
Ø Kinder in gefährlicher
Arbeit: Kinder, die Tätigkeiten verrichten, die ihrer Natur nach schädlich für
die Sicherheit, die körperliche oder seelische Gesundheit und die sittliche
Entwicklung des Kindes sind. Gefahren können auch von übermäßiger Arbeitsbelastung,
den physischen Arbeitsbedingungen und der Arbeitsintensität (Arbeitsdauer)
ausgehen. (Anmerkung*3)
In
folgenden Produkten kann ausbeuterische Kinderarbeit stecken:
a)
Lebensmittel
Kinderarbeit
bei Anbau, Ernte und zum Teil bei der Weiterverarbeitung Bananen, Gewürze,
Kaffee, Kakao, Orangensaft, Reis, Schokolade, Süßigkeiten, Tee, tropische
Früchte, Zucker (aus Zuckerrohr).
b)
Konsumgüter und Dienstleistungen
Bekleidung
und Berufsbekleidung (Anbau von Baumwolle, Seidengewinnung, spinnen, färben,
nähen, verpacken); Blumen (Anbau und Ernte); Diamanten, Edelsteine, Strass
(Schneiden und schleifen); Feuerwerkskörper (Fertigung); Fußbälle und andere
Lederbälle (Nähen); Handys und Telekommunikation (Gewinnung von Coltan);
Heimtextilien z.B. Tischwäsche, Gardinen, etc. (Anbau von Baumwolle, Seidengewinnung,
spinnen, färben, nähen, verpacken); Kosmetik (Rohstoffgewinnung);
Sportbekleidung (Anbau von Baumwolle, spinnen, färben, nähen, verpacken);
Schuhe/ Sportschuhe (Gerbereien, Fertigung, verpacken); Natursteine z.B. Bau-
und Grabsteine (Arbeit in Steinbrüchen, schneiden und polieren); Teppiche
(Wolle spinnen, Teppiche knüpfen, waschen); Tourismus/Gastronomie (Putzen,
Gepäcktragen, kellnern, kochen, spülen). U.a.m.
Schlussbemerkung
erster Teil
Es
steht fest, dass hinter der mit der notwendigen Sachlichkeit geführten Debatte
die nackte Not den Alltag vieler Millionen Kinder prägt und wir sollten es
nicht allein den internationalen Organisationen überlassen, etwas gegen dieses
Leid zu tun – oft tritt dabei das Phänomen „Lange Bank“ zutage. Insofern ist es
für diese Kinder gut, wenn wir auch mit dem Herzen sehen und unseren Emotionen
Raum geben, wenn wir uns aufregen
und einmischen, wenn wir Verantwortliche anprangern… und uns auch selbst
prüfen. Wenn wir uns fragen, warum das alles so bleibt, wo doch alle drüber
Bescheid wissen, muss uns das doch wütend machen…
Wilfried
John
Teil
II befasst sich mit der Frage warum Kinder ausgebeutet werden.
Anmerkung
*1
»Erwerbstätigkeit«
nach Definition der ILO: »"Erwerbstätigkeit" ist ein dehnbarer
Begriff, der die meisten produktiven Tätigkeiten von Kindern umfasst,
ungeachtet dessen, ob sie für den Markt bestimmt sind oder nicht, bezahlt oder
unbezahlt sind, ob es sich um einige wenige Stunden oder eine vollzeitliche,
Gelegenheits- oder reguläre Arbeit handelt und ob sie rechtmäßig oder
unrechtmäßig ist; häusliche Pflichten und Schularbeit schließt dieser Begriff
aus. Als erwerbstätig gilt ein Kind, das mindestens eine Stunde an einem Tag
innerhalb eines Referenzzeitraums von sieben Tagen arbeitet.
"Erwerbstätige Kinder" ist weniger eine rechtliche als vielmehr eine statistische Definition.«
Quelle:
Das Ende der Kinderarbeit – Zum Greifen nah. Gesamtbericht im Rahmen der
Folgemaßnahmen zur Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte
bei der Arbeit, Internationales Arbeitsamt, Genf, 2006, S. 6
Anmerkung
*2
»Gefährliche
Arbeit« nach Definition der ILO: »Von Kindern verrichtete "gefährliche
Arbeit" ist jede Tätigkeit oder Beschäftigung, die sich ihrer Natur nach
schädlich auf die Sicherheit, die körperliche oder seelische Gesundheit und die
sittliche Entwicklung des Kindes auswirkt oder auswirken kann. Gefahren können
auch von einer übermäßigen Arbeitsbelastung, den physischen Arbeitsbedingungen
und/oder der Arbeitsintensität im Sinne von Arbeitsdauer oder geleisteten Arbeitsstunden
ausgehen, selbst dann, wenn eine Tätigkeit oder Beschäftigung als nicht
gefährlich oder als "sicher" gilt. Diese Arten von Arbeit müssen auf
nationaler Ebene nach dreigliedrigen Konsultationen in einer Liste erfasst
werden.«
Quelle:
Das Ende der Kinderarbeit – Zum Greifen nah. Gesamtbericht im Rahmen der
Folgemaßnahmen zur Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte
bei der Arbeit, Internationales Arbeitsamt, Genf, 2006, S. 6
Anmerkung
*3
»Kinderarbeit«
nach Definition der ILO: »"Kinderarbeit" ist ein engerer Begriff als
"erwerbstätige Kinder"; er schließt alle Kinder über 12 Jahren aus,
die nur einige Stunden pro Woche eine erlaubte leichte Arbeit verrichten, sowie
Kinder über 15 Jahren, deren Arbeit nicht als "gefährlich" eingestuft
wird. Grundlage für den Begriff der "Kinderarbeit" ist das IAO-Übereinkommen (Nr. 138) über das Mindestalter,
1973, das die umfassendste und maßgeblichste internationale Definition des
Mindestalters für die Zulassung zu Beschäftigung oder Arbeit im Sinne einer
"Erwerbstätigkeit" enthält. - 4 Siehe IPEC: Every child counts,
a.a.O., S. 29-34.«
Quelle:
Das Ende der Kinderarbeit – Zum Greifen nah. Gesamtbericht im Rahmen der
Folgemaßnahmen zur Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte
bei der Arbeit, Internationales Arbeitsamt, Genf, 2006, S. 6
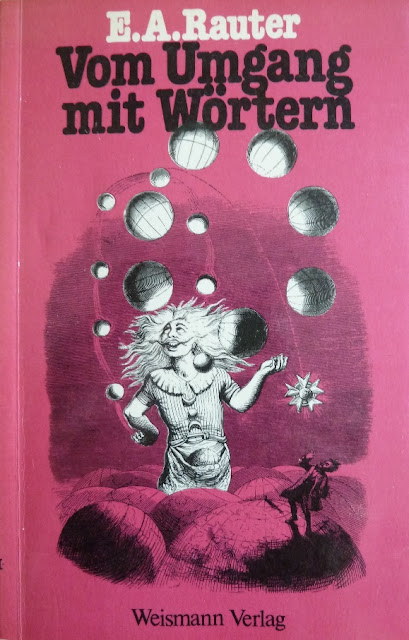

Kommentare
Kommentar veröffentlichen